Ärztliche Praxis (17.-19. Jahrhundert)
Die Praxisjournale Johann Friedrich Glasers (1750-1763) aus Suhl (Thüringen)
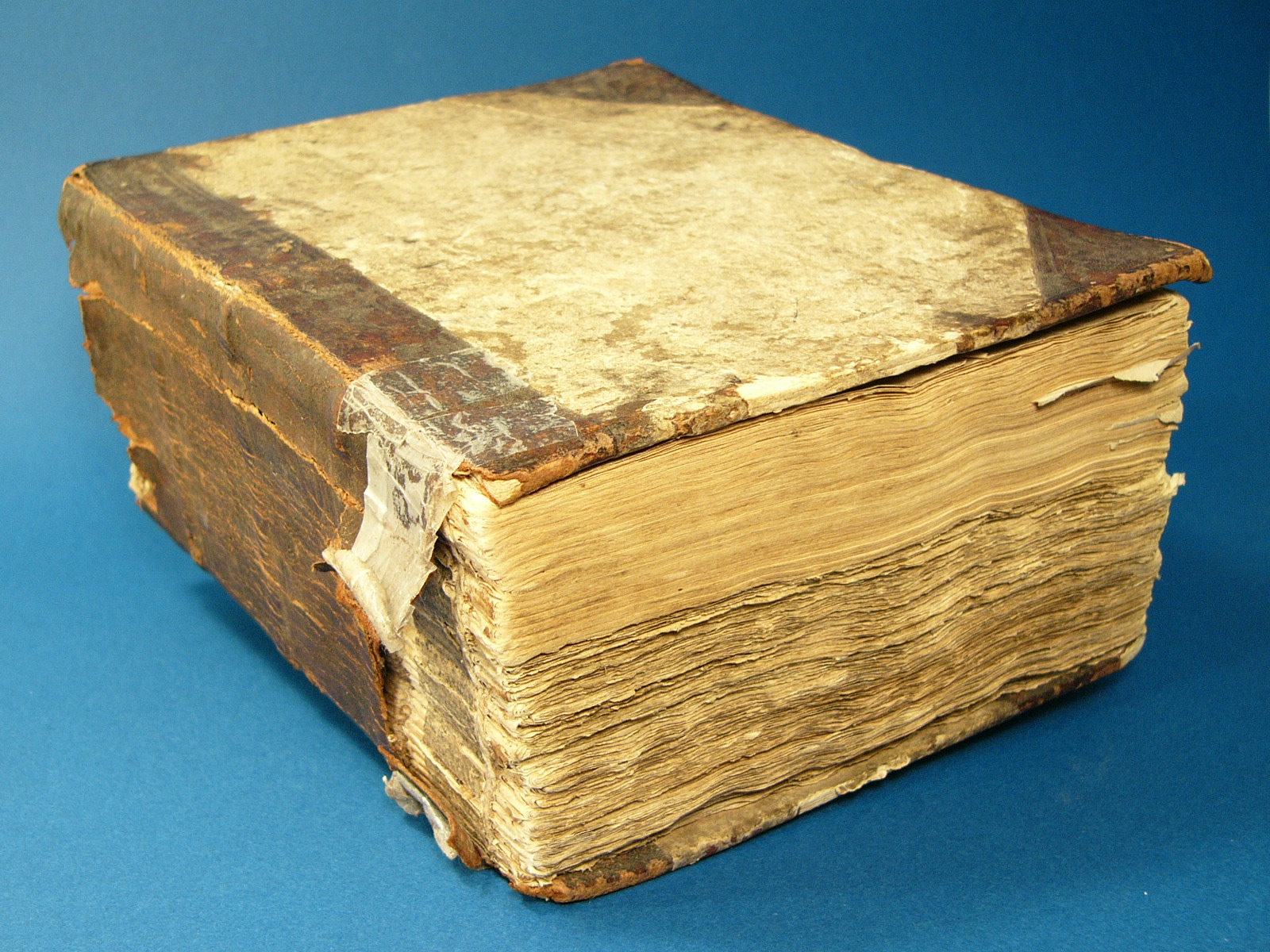
Ziel des Forschungsprojektes ist erstens die Rekonstruktion einer ärztlichen Praxis aus der
Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie soll als ein Fallbeispiel für die übergeordnete Fragestellung
nach der Einbettung ärztlichen Handelns im sozialen Kontext dienen, die ihm
Forscherverbund
Ärztliche Praxis (17.-19. Jahrhundert) vergleichend untersucht wird.
Zweitens sollen die der handschriftlichen Quelle zugrunde liegenden Aufschreibetechniken
analysiert und ihre Funktion als Wissenstechnik herausgearbeitet werden. Materielle
Grundlage des Forschungsvorhabens ist ein Praxistagebuch Johann Friedrich Glasers, das auf
1200 Seiten seine Tätigkeit in den Jahren 1750 bis 1763 dokumentiert. Johann Friedrich
Glaser praktizierte seit 1738 in Suhl, wo er zwanzig Jahre später die Position des Stadt- und
Amtsphysicus bekleidete. Er war Mitglied zahlreicher Akademien der Wissenschaften. Dank
seiner umfangreichen Publikationsliste ist es möglich, sein medizinisches Handeln mithilfe
einer dichten Diskursanalyse wissenschaftshistorisch einzuordnen.
Bei Vorarbeiten wurden mehrere interpretationsbedürftige Ergebnisse gewonnen, die zurzeit
näher untersucht werden:
Johann Friedrich Glaser ging nicht auf Reisen, sondern praktizierte im eigenen Haus. Dies
steht im Widerspruch zu dem in der Forschung verbreiteten Bild des 'reisenden Arztes'. Zu
eruieren ist, warum sich Glaser erlauben konnte, seine Patienten zu sich kommen zu lassen.
Dank Glasers Beschreibungen in den von ihm veröffentlichten gedruckten Schriften und
seiner Korrespondenz können wir uns eine Vorstellung vom Alltag in dieser Praxis in Suhl
machen.
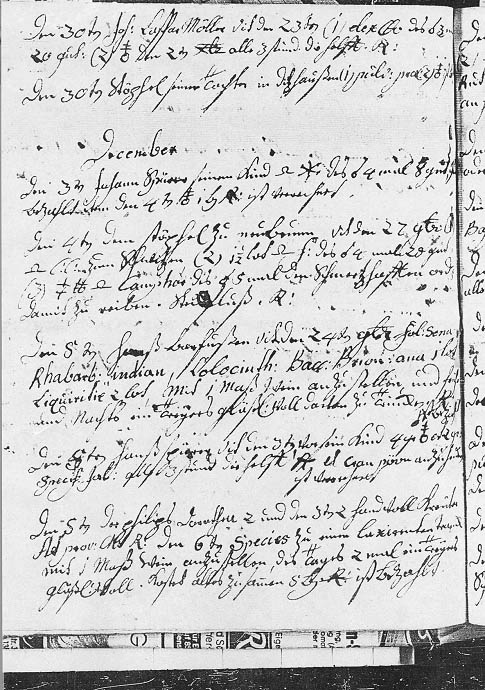
So spricht er beispielsweise von ca. 800 Büchern, die er in seinem Wohnhaus, in
dem er auch praktiziert hatte, besaß und auch davon, dass er in und vor seinem Wohnhaus
physikalische und chemische Experimente anstellte. Um die Position Glasers in der
medizinischen Welt Suhl und seiner Umgebung angemessen beurteilen zu können, ist es
notwendig, die materiellen Bedingungen seines ärztlichen Handelns in seiner Praxis zu
rekonstruieren.
Ungefähr ein Drittel der Patienten konsultierte Glaser nur über Boten. Obwohl er Stadtarzt
von Suhl war, behandelte Glaser zu einem großen Teil Patienten, die nicht aus Suhl, sondern
aus den Dörfern aus der näheren und weiteren Umgebung stammten. Die geographische
Verortung der Heimatorte seiner Patienten zeigt, welche Wege die Angehörigen der Patienten
und sie selbst bereit waren, auf sich zu nehmen. Somit kann rekonstruiert werden, wie weit
der Einfluss der stadtärztlichen Praxis reichte und wie eng das städtische und ländliche
Medizinalwesen in Suhl und Umgebung zur Mitte des 18. Jahrhunderts miteinander
verflochten waren.
Glaser beschränkte sich ausschließlich auf "innere Kuren" und enthielt sich jedes Übergriffs
in das chirurgische Fachgebiet. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass
Glaser mütter- und väterlicherseits aus Scharfrichterfamilien stammte und eine Schrift über
ein von ihm selbst entwickeltes Blutmessgeschirr verfasste. Es ist also zu fragen, in welchem
Zusammenhang die medizinische Tätigkeit, die das Praxistagebuch dokumentiert, zu dem
Gesamtwissen Glasers stand: Zeigt es nur den Ausschnitt, der mit seinem Selbstverständnis
als akademisch gebildeter Arzt vereinbar war? Außerdem ist es aufschlussreich zu
untersuchen, ob und wie sich die Diagnostik und Therapeutik im Laufe der dreizehn Jahre, die
das Buch umfasst, veränderte. Das geschieht mit Hilfe der Transkription und Analyse
ausgewählter Jahre und Monatsreihen seines Praxistagebuchs. — Volker Hess
Volker Hess — ausgewählte Publikationen mit Bezug zum Forschungsprojekt (Stand: 5. April 2011)
- Volker Hess und Sophie Ledebur: Taking and Keeping. A note on the emergence and function of hospital patient records. Journal of the Society of Archivists 32 (2011), 21-32.
- Volker Hess: Formalisierte Beobachtung. Die Genese der modernen Krankenakte am Beispiel der Berliner und Pariser Medizin (1725-1830). Medizinhistorisches Journal 45 (2010), 293-340.
- Volker Hess und Andrew J. Mendelsohn: Case and series: Medical knowledge and paper technology, 1600-1900. History of Science 48 (2010), 287-314.
- Volker Hess: Das Medizinaledikt von 1685. Die Anfänge ärztlicher Standesvertretung zwischen korporativer Autonomie und staatlicher Behörde. Berliner Ärzte 47.8 (2010), 16-19.
- Volker Hess: Der Wandel der Krankengeschichte durch die Entwicklung der Krankenhausverwaltung. Ein altbekanntes Instrument im Wandel der Zeit. Klinikarzt 37 (2008), 27-30.
Ruth Schilling — ausgewählte Publikationen mit Bezug zum Forschungsprojekt (Stand: 5. April 2011)
- Ruth Schilling: Amtsträger und Wissenschaftler — die Repräsentationsstrategien eines Scharfrichtersohns in der Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Annika Höppner (Hg.), Kommunikation sozialer Mobilität, voraussichtlich in: Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte 2011 (in Vorbereitung).
- Ruth Schilling: Stadt und Arzt im 18. Jahrhundert. Johann Friedrich Glaser, Stadtphysicus in Suhl, in: Würzburger Medizinhistorische Mitteilungen 2011 (in Vorbereitung)
- Ruth Schilling, Sabine Schlegelmilch und Susan Splinter: Stadtarzt oder Arzt in der Stadt? Drei Ärzte der Frühen Neuzeit und ihr Verständnis des städtischen Amtes, soll eingereicht werden bei: Medizinhistorisches Journal (in Vorbereitung)